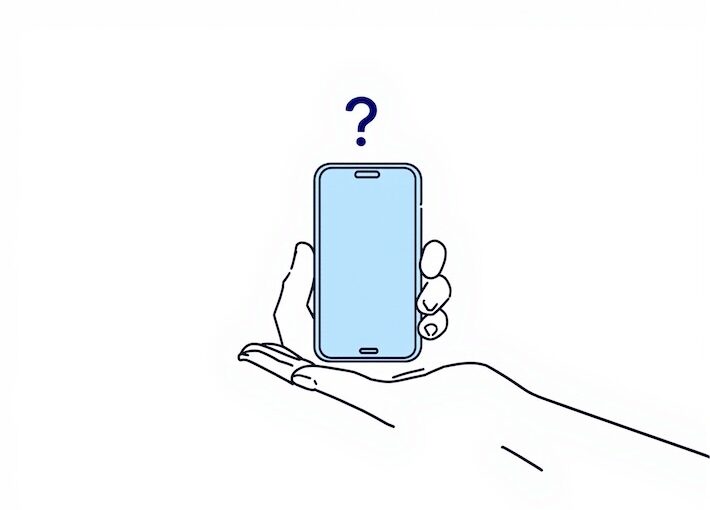Die Frage, wann die Wegnahme eines Smartphones als räuberischer Diebstahl strafbar ist, wenn es gar nicht um das Gerät an sich geht, stellt Gerichte vor Herausforderungen: Besonders problematisch sind Fälle, in denen der Täter das Gerät nicht aus Bereicherungsabsicht entwendet, sondern um darauf gespeicherte Daten zu überprüfen oder zu löschen.
Der Bundesgerichtshof (4 StR 308/25) hat in einem aktuellen Beschluss klargestellt, dass eine Zueignungsabsicht im Sinne des § 252 StGB nicht automatisch vorliegt, wenn das Handy nur zur Beweisführung an sich gebracht wird. Dabei zeigt sich, wie eng die Grenzen zwischen strafbarem räuberischen Diebstahl und bloßer Gebrauchsanmaßung verlaufen.
Smartphone als Beweismittel
Der Angeklagte hatte den Verdacht, dass der Zeuge eine außereheliche Beziehung mit seiner Ehefrau unterhielt. Gemeinsam mit seinem Sohn lauerte er dem Zeugen auf einem Parkplatz auf, bedrohte ihn mit einem Messer und einer mit Benzin gefüllten Flasche und nahm ihm das Smartphone weg.
Sein Ziel war es, das Gerät nach belastendem Material – etwa Nachrichten oder Fotos – zu durchsuchen. Das Landgericht Essen verurteilte ihn wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Der BGH hob dieses Urteil nun auf, weil die notwendige Zueignungsabsicht nicht ausreichend belegt war.
Die rechtliche Problematik: Wann liegt Zueignungsabsicht vor?
Nach § 252 StGB macht sich der Täter eines räuberischen Diebstahls strafbar, wenn er eine fremde bewegliche Sache wegnimmt, um sie sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen. Der BGH betont, dass Zueignungsabsicht nur dann gegeben ist, wenn der Täter die Sache unter Ausschluss des Eigentümers oder bisherigen Gewahrsamsinhabers körperlich oder wirtschaftlich seinem Vermögen oder dem eines Dritten zuführen will. Dies setzt nicht zwingend voraus, dass er die Sache auf Dauer behalten möchte. Entscheidend ist, dass er sie zumindest vorübergehend als eigene behandeln will:
Zueignungsabsicht ist gegeben, wenn der Täter im Zeitpunkt der Wegnahme die fremde Sache unter Ausschließung des Eigentümers oder bisherigen Gewahrsamsinhabers körperlich oder wirtschaftlich für sich oder einen Dritten erlangen und sie der Substanz oder dem Sachwert nach seinem Vermögen oder dem eines Dritten „einverleiben“ oder zuführen will (…). Das setzt nicht notwendig voraus, dass er sie auf Dauer behalten will. Unerheblich ist etwa der Vorbehalt, sich der Sache nach Gebrauch zu entledigen. Desgleichen kann die Zueignungsabsicht auch bei einer Wegnahme mit dem Willen vorhanden sein, die Sache zunächst zu behalten und sich erst später darüber schlüssig zu werden, wie über sie zu verfügen sei (…).
Dagegen fehlt es an dieser Voraussetzung in Fällen, in denen der Täter die fremde Sache nur wegnimmt, um sie zu zerstören, zu vernichten, preiszugeben, wegzuwerfen, beiseitezuschaffen oder zu beschädigen, wie ferner bei bloßer Gebrauchsanmaßung, also in der Regel dann, wenn er schon bei der Wegnahme den bestimmten Willen hat, die Sache dem Berechtigten unverändert zurückzugeben und so den rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen (…).
Entsprechend verhält es sich in Fällen, in denen der Täter ein Mobiltelefon lediglich in der Absicht wegnimmt, dort abgespeicherte Bilder zu löschen. Eine Zueignungsabsicht ist in solchen Konstellationen nur dann zu bejahen, wenn der Täter das Mobiltelefon zum Zeitpunkt der Wegnahme – wenn auch nur vorübergehend – über die für die Löschung der Bilder benötigte Zeit hinaus behalten will (…).
Also fehlt es im Ergebnis an dieser Absicht, wenn der Täter das Smartphone lediglich wegnehmen will, um es zu zerstören, zu beschädigen oder – wie im vorliegenden Fall – um darauf gespeicherte Daten zu überprüfen oder zu löschen. Der BGH hat in früheren Entscheidungen bereits klargestellt, dass eine Zueignungsabsicht nur dann vorliegt, wenn der Täter das Mobiltelefon über die für die Löschung oder Überprüfung benötigte Zeit hinaus behalten will. Eine bloße Gebrauchsanmaßung, bei der der Täter die Sache nach der Nutzung zurückgeben oder vernichten will, reicht nicht aus.

Klare Abgrenzung zwischen Diebstahl und Gebrauchsanmaßung
Auch einem Laien wird hier deutlich, wie wichtig eine präzise Abgrenzung zwischen strafbarem räuberischen Diebstahl und bloßer Gebrauchsanmaßung ist. Denn nicht jede Wegnahme eines Smartphones erfüllt den Tatbestand eines Raubdelikts oder Diebstahls. Der Täter muss vielmehr die Absicht haben, das Gerät zumindest vorübergehend seinem Vermögen zuzuführen. Wenn das Smartphone lediglich als Beweismittel dient und der Täter es nach der Überprüfung zurückgeben oder vernichten will, fehlt es an der notwendigen Zueignungsabsicht. Dies ist nicht neu, denn es gibt bereits mehrere Entscheidungen des BGH zu diesem Thema. Da die „Lücke” an dieser Stelle bekannt ist, hat der Gesetzgeber den unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs in § 248b StGB gesondert unter Strafe gestellt.
In der Praxis müssen Gerichte in solchen Fällen besonders sorgfältig prüfen, ob der Täter das Smartphone tatsächlich als eigene Sache behandeln wollte oder ob es ihm nur um die darin gespeicherten Daten ging. Allerdings muss man aufpassen: So kann das Löschen von Daten (zumindest wenn sie einen nicht selbst betreffen) das „Gerieren als Eigentümer“ bedeuten und damit eine Zueignung begründen. Ebenso wird man über Datendelikte im Einzelfall nachdenken müssen. Die Entscheidung zeigt also, dass die innere Tatseite, also die Absicht des Täters, im Mittelpunkt der Beweiswürdigung stehen muss, aber eben auch, dass es nicht per se straflos ist.
Keine selbsterklärende Zueignungsabsicht
Das Landgericht Essen hatte angenommen, dass der Angeklagte das Smartphone in der Absicht weggenommen habe, es für sich zu behalten. Der BGH kritisierte jedoch, dass diese Annahme nicht ausreichend begründet wurde. Die Jugendkammer hatte ihre Überzeugung maßgeblich damit begründet, dass der Angeklagte das Handy an sich bringen wollte, um zu überprüfen, ob seine Ehefrau ein Verhältnis mit dem Geschädigten unterhielt. Dies belege jedoch nur einen zeitlich eng begrenzten Besitzwillen, der sich auf die Dauer der Überprüfung beschränke.
Der BGH stellte klar, dass das bloße Einstecken des Smartphones in die Jackentasche nicht automatisch auf eine Zueignungsabsicht schließen lasse. Vielmehr sei dieser Vorgang auch damit erklärbar, dass der Angeklagte das Gerät nur kurzzeitig sichern wollte, um die Daten zu prüfen. Ohne weitere Indizien, die auf einen darüber hinausgehenden Aneignungswillen hindeuten, könne nicht von einer Zueignungsabsicht ausgegangen werden. Die bloße Tatsache, dass der Angeklagte das Handy nicht sofort zurückgab, reiche nicht aus, um eine strafbare Zueignung zu bejahen.
Aufhebung des Urteils und neue Verhandlung: Da die Zueignungsabsicht damit nicht ausreichend belegt war, hob der BGH den Schuldspruch wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls auf. Diese Aufhebung erstreckt sich auch auf die Verurteilung wegen tateinheitlich begangener gefährlicher Körperverletzung, da beide Delikte in einem engen Zusammenhang stehen (es zeigt sich damit, dass Fehler in einem Bereich ein Urteil insgesamt infizieren können!). Die Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen blieben jedoch bestehen, da sie von dem Rechtsfehler nicht betroffen sind. Die Sache wurde zur neuen Verhandlung und Entscheidung an eine andere Jugendkammer des Landgerichts Essen zurückverwiesen.
- BVerfG zu ANOM: Vertrauen ohne Kontrolle? - 6. Oktober 2025
- BGH zur Zueignungsabsicht bei Wegnahme eines Smartphones zur Beweissicherung - 5. Oktober 2025
- Endlose Wartezeit: Wenn die Staatsanwaltschaft Daten jahrelang sichert - 22. September 2025