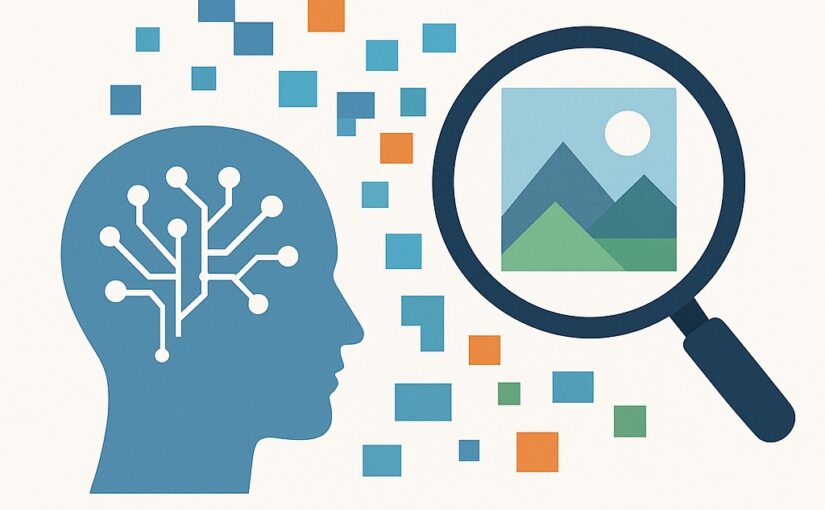Die Digitalisierung hat die Strafverfolgung nachhaltig verändert … wo früher Aktenordner durchforstet wurden, sind es heute Festplatten, Cloud-Speicher und Smartphones, die als Beweismittel im Fokus der Ermittler stehen. Doch mit der technischen Entwicklung wachsen auch die Herausforderungen: Die Auswertung digitaler Datenbestände dauert oft monate- und manchmal sogar jahrelang.
Was aber passiert, wenn die Staatsanwaltschaft Speichermedien über Jahre hinweg sichert, ohne dass eine zügige Auswertung in Sicht ist? Mit dieser Frage hat sich kürzlich das Landgericht Essen (25 Qs-20/25) in einem Beschluss befasst, der für Betroffene von Durchsuchungen von großer Bedeutung ist.
Endlose Wartezeit: Wenn die Staatsanwaltschaft Daten jahrelang sichert weiterlesen