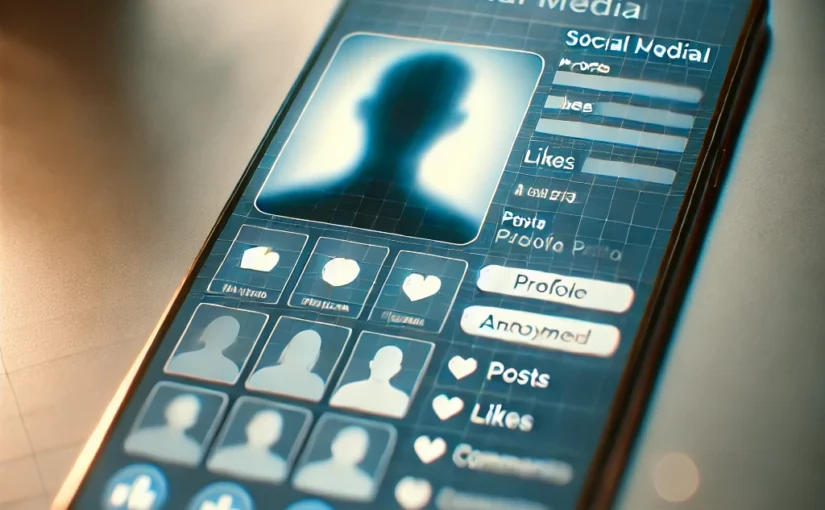Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 24. Juni 2025 (Az. 3 StR 138/25) reiht sich ein in eine Reihe bedeutsamer Klarstellungen zur prozessualen Stellung der Verteidigung im Strafprozess – insbesondere im Umgang mit Beweismitteln. Im Zentrum steht eine ebenso praktische wie grundsätzliche Frage: Darf die Verteidigung ein physisches Beweisstück aus amtlicher Verwahrung herausverlangen, um mit dem Mandanten eigene, unbeaufsichtigte Ermittlungen durchzuführen?
Der BGH hat diese Frage klar verneint. Doch was zunächst formaljuristisch schlicht wirkt, berührt in der Tiefe den sensiblen Bereich der Waffengleichheit, des rechtlichen Gehörs und des Beweiszugangs der Verteidigung – mit erheblichen Auswirkungen auf die Praxis, insbesondere bei digitalen oder sensiblen Beweismitteln.
Der Fall und die Entscheidung des BGH
Ausgangspunkt war eine Revision in einem Verfahren wegen besonders schwerer sexueller Nötigung. Die Verteidigung hatte beantragt, ein Beweisstück – konkret: ein amtlich verwahrtes Beweismittel – zur eigenen Untersuchung durch den Mandanten zu erhalten. Ziel war es, unter Ausschluss der Ermittlungsbehörden bzw. gerichtlicher Kontrolle Erkenntnisse zu gewinnen, die gegebenenfalls der Entlastung dienen könnten.
Der BGH erteilte dieser Vorstellung eine deutliche Absage. Die §§ 32f, 147 StPO geben – so der Senat – keine Grundlage für eine Aushändigung von amtlich verwahrten Beweisstücken an die Verteidigung zum Zweck unbeaufsichtigter Untersuchung. Auch die Möglichkeit, das Beweisstück im Rahmen gerichtlicher Einsichtnahmen oder über technische Reproduktionen (z. B. Kopien, Abbildungen, Sicherungskopien) zu untersuchen, sei ausreichend und genüge dem Gebot des fairen Verfahrens.
Juristischer Hintergrund: Einsichtsrecht vs. Herausgabeanspruch
Die Entscheidung stellt klar: Ein Einsichtsrecht nach § 147 Abs. 1 StPO – das die Akteneinsicht und mittelbar auch die Einsichtnahme in bestimmte Beweismittel umfasst – ist nicht mit einem Herausgabeanspruch gleichzusetzen. Die Strafprozessordnung kennt gerade keine Norm, die es der Verteidigung gestattet, Beweisstücke zur freien Verwendung aus amtlicher Verwahrung zu entnehmen.
Zwar wurde im Lichte des Grundsatzes des fairen Verfahrens (Art. 6 EMRK, Art. 103 Abs. 1 GG) die Bedeutung einer effektiven Verteidigung betont. Doch wie der BGH verdeutlicht, umfasst diese nicht das Recht auf eigenständige, unbeaufsichtigte Beweiserhebungen außerhalb der gerichtlichen Kontrolle. Ein solches Verständnis würde den prozessualen Ordnungsrahmen aushebeln und etwaige Manipulationsgefahren eröffnen.
Diese Sichtweise findet Rückhalt in der Fachliteratur und den allgemeinen Grundsätzen des Strafverfahrens: Der Zugang zu Beweismitteln ist durch staatliche Verantwortung flankiert. Auch und gerade im Hinblick auf digitale oder leicht manipulierbare Beweise ist eine verlässliche Sicherung der Integrität essentiell.
Relevanz für den Umgang mit digitalen Beweismitteln
Die Entscheidung ist besonders bedeutsam im Zeitalter digitaler Beweismittel. Die Verteidigung kann – wie bei der Sicherung digitaler Images oder von Mobilgeräten – berechtigtes Interesse daran haben, Beweismittel eigenständig mit Sachverständigen analysieren zu lassen. Dabei stellt sich zunehmend die Frage nach dem Zugriff auf originäre Datenquellen: Festplatten, Datenträger, Geräte. Die Verteidigung möchte sicherstellen, dass etwa forensische Images vollständig und unverändert vorliegen – ein legitimes Anliegen im Spannungsfeld zwischen Integritätssicherung und Waffengleichheit.
Doch genau an diesem Punkt greift die Entscheidung des BGH ein: Sie markiert die Grenze dort, wo die staatliche Beweismittelsicherung in amtliche Verwahrung übergeht. Das Konzept der „gerichtsfesten IT-Forensik“ – wie in der einschlägigen Literatur betont – verlangt nach einer transparenten, dokumentierten und jederzeit überprüfbaren Beweismittelkette.
Ein unbeaufsichtigter Zugriff durch die Verteidigung würde diese Anforderungen unterlaufen. Nicht ausgeschlossen bleibt jedoch, dass Kopien (etwa forensische Images) überlassen werden – stets unter Wahrung der Beweis- und Manipulationssicherheit.

Stillstand
Die Entscheidung des BGH führt zu einer notwendigen Klärung, setzt jedoch ein deutliches Signal in Richtung staatlicher Beweisautorität. Im Zeitalter digitaler Spuren, wo technische Sachverhalte und forensische Details die Beweisführung dominieren, braucht es ein sensibles Gleichgewicht zwischen Beweiszugang und Beweisintegrität.
Die Verteidigung ist gehalten, ihre Rechte über die bekannten Mittel – Beweisantrag, Antrag auf Einholung eines eigenen Gutachtens, gerichtliche Anträge auf Einsichtnahme – durchzusetzen. Ein Recht auf Herausgabe originärer Beweisstücke zur freien Verfügung besteht nicht. In der Konsequenz stärkt die Entscheidung das Vertrauen in die formalisierte Beweismittelsicherung, verlangt aber auch nach einer verantwortungsvollen gerichtlichen Kontrolle zur Wahrung der Verteidigungsrechte.
Bewertung mit Blick auf die Waffengleichheit
Kritiker mögen einwenden, dass die Entscheidung die Verteidigung strukturell schwächt. Der BGH begegnet dieser Sichtweise mit einem formal-prozeduralen Argument: Die Möglichkeiten der Verteidigung zur Antragstellung, Sachverständigenbenennung und gerichtlichen Beweiserhebung bestehen weiterhin. Auch die Einsicht in Kopien und Protokolle bleibt möglich – dies sei ausreichend.
In der forensischen Praxis stellt sich jedoch häufig das Problem, dass Originaldaten aus forensischen Sicherungen nicht vollständig oder fehlerfrei nachvollzogen werden können. Der Zugang zum „Originaldatenträger“ – etwa zur Überprüfung von Zeitstempeln, Dateistruktur oder Hidden Data – ist daher kein bloßer Formalismus, sondern kann im Einzelfall entscheidende Bedeutung erlangen.
Der BGH bleibt dennoch bei seiner Linie: Die staatliche Kontrolle der Beweismittel steht im Rang über einem schrankenlosen Verteidigungsanspruch. Letztlich wird das Gericht darüber zu wachen haben, ob und in welchem Rahmen sachverständige Gegenprüfung durch die Verteidigung zulässig und notwendig ist. Es bleibt damit bei einer prozessualen Zugriffsmöglichkeit, aber ohne Besitzübergang.
- BVerfG zu ANOM: Vertrauen ohne Kontrolle? - 6. Oktober 2025
- BGH zur Zueignungsabsicht bei Wegnahme eines Smartphones zur Beweissicherung - 5. Oktober 2025
- Endlose Wartezeit: Wenn die Staatsanwaltschaft Daten jahrelang sichert - 22. September 2025